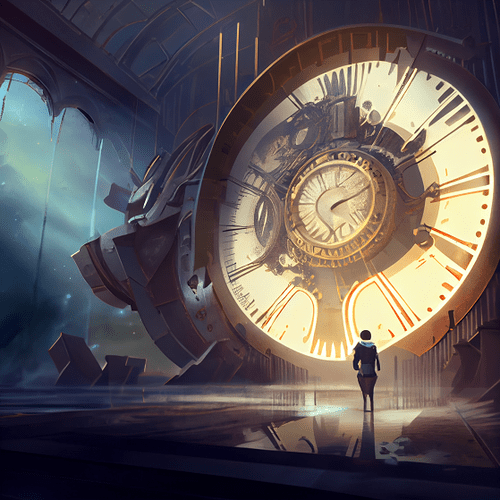Herzlichen Glückwunsch, mein Wunder
„Sind sie so empfindlich?“
„Woher soll ich das wissen? Das ist mein erstes Kind!“, blaffe ich die Krankenschwester an und es tut mir nicht einmal leid. Seit mehr als 24 Stunden liege ich in diesem Krankenhausbett, atme Desinfektionsmitteldämpfe ein, starre die weißen Wände und die weiße Bettdecke an, habe Wehenhemmer und eine Lungenreifespritze bekommen und notgedrungen ungenießbares Brot mit bleicher Wurst und Käse verdrückt. In der gerade erst schwindenden Nacht habe ich drei Schwestern um ein zusätzliches Kissen für meinen Rücken gebeten, der mich schier umbringen will, und nicht mehr als mitleidige Blicke erhalten. Meine Geduld ist so ziemlich aufgebraucht, ich bin hundemüde, aber das interessiert wirklich keinen auf dieser Station. Ist ja auch kein Wunder! Hier wird im Minutentakt entbunden.
Mein Untermieter hat eigentlich noch einen Mietvertrag über anderthalb Monate. Genau sechs Wochen. Seit genau so vielen Wochen liegt er mit seinem zarten Po voran, den Beinen an den Ohren und der Nase den Sternen zugewandt, total verkehrt herum, in seiner kuscheligen Höhle. Für die Ärzte und Schwestern steht daher unumstößlich fest, dass sie dem jungen Herren per Kaiserschnitt, aber heute natürlich nicht vor dem Mittagstisch, bei seinem ersten Umzug helfen werden.
Mir ist dieser Räumungsbescheid zwar bekannt, der Termin aber gänzlich unerwünscht, denn eigentlich hätte ich an diesem Montagmorgen gern hochkonzentriert in der ersten Zivilrechtsklausur für das zweite juristische Staatsexamen gesessen, und mir das Gehirn über fiktive Probleme zermartert statt echte auszubrüten.
Aber bei meiner Planung hat der Krümel sich wohl bereits ins Fäustchen gelacht und gedacht:
„Oh, Mann, wie langweilig! Fünf Stunden still sitzen ohne Geschaukel und Musik? Kenne ich schon. Das geht gar nicht!“
Und ich bin mir in diesen Minuten unter Schmerzen und Hitzewallungen und dem Bedürfnis mich einfach nur zu übergeben, absolut sicher, dass der Kleine genauso wenig von den Plänen des Krankenhauspersonals hält, wie von meinen. Aber wie soll ich denen das begreiflich machen? Schließlich habe ich nur Jura studiert, aber vom Kinderkriegen und vom Leben, das sich über meine Pläne platt lacht, keine Ahnung!
„Egal, ob ich überempfindlich bin oder nicht“, presse ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor: „die Rückenschmerzen werden, in immer kürzeren Intervallen, immer heftiger. Wenn Sie nichts weiter für mich tun können, bringen Sie mir bitte endlich das besch… Kissen für den Rücken oder ich mache mich selbst auf die Suche. Und sagen Sie dem Oberarzt und dem Anästhesisten Bescheid, dass ich nicht glaube, wirklich gar nicht, dass dieses Kind sich noch bis Mittag Zeit lässt.“
Ich sehe auf die Uhr an der gegenüberliegenden Wand, es ist 7.26 Uhr. Das sind noch fünfeinhalb Stunden bis zum geplanten Kaiserschnitt. Bis dahin bin ich tot. Umgebracht von diesen verdammten Rückenschmerzen! In den Wahnsinn getrieben von überarbeiteten Krankenschwestern. Keine Ahnung, wer dann das Kind auf die Welt bringt. Ich nicht!
Ich sehe das mitleidige Gesicht der jungen Schwester, das skeptische der älteren, die mir wieder versichert, der Wehenschreiber würde keine Wehen anzeigen und ich hätte noch Zeit, sei ja meine erste Geburt. Ich fühle die Schmerzwelle im Rücken, die mich anschreit, dass da keine Nadel zur Betäubung reingejagt werden wird. Sehe die Zettel, die ich jetzt ausfüllen soll, für die Narkose am Mittag. Sind die alle irre? Ich bin hier absolut im falschen Film.
Übelkeit steigt in mir auf. Ich atme sie mühsam weg. Keine Ahnung, wie das richtig geht. Ich war erst einmal in diesem verdammten Geburtsvorbereitungskurs.
Ich konnte ja nicht ahnen, dass in mir ein Mietnomade heranwächst und sich bereits nach 34 Wochen verändern will! So gechillt, wie er in den letzten Wochen drauf war… wer kommt denn auf die Idee, dass einer, der zu faul ist sich zu drehen, auf einmal zum Abenteurer mutiert? Das genau derselbe kleine Faulpelz es auf einmal wahnsinnig eilig hat, diese kalte, graue, matschige Dezemberwelt zu erkunden? Wahrscheinlich hat er in seiner Unfähigkeit, einfach wild Purzelbäume in mir zu schlagen, festgestellt, dass ihm das Ambiente nicht mehr gefällt. Klar, ich hab vergessen Weihnachtsschmuck aufzuhängen! Jetzt will er ein Zimmer mit Aussicht auf den hell erleuchteten Weihnachtsmarkt.
Aber bitte pronto!
Apropos eilig…der werdende Vater hat immer noch keine Ahnung… die Schwestern wollten ihn ja vorhin noch nicht wecken. Echt witzig. Das ich wegen meiner Rückenschmerzen nicht schlafen konnte, war denen Schnuppe, selbst nach meinem Klingeln gegen drei Uhr und fünf Uhr.
„Können sie jetzt bitte meinen Mann anrufen, dass er ins Krankenhaus kommt? Ist mir egal, ob sie denken, er hätte noch Zeit.“
„Wir versuchen ihn zu erreichen.“
Sie erreichen ihn natürlich nicht. Die Geburt wird eine eilige Notentbindung, ohne Kaiserschnitt, denn während alle philosophierten, steckte der Zwerg bereits die ganze Zeit im Geburtskanal fest.
Uups! Tut uns aber Leid!
Um 8.27 Uhr wird er blitzeblau, ohne jedes Anzeichen von Atmung, auf die Neonatologie getragen. Und mir ist alles, alles was sein sollte, alle Pläne, Prüfungen, meine Schmerzen, meine Übelkeit, der eklige Krankenhausgeruch, Weihnachten, alles ist mir egal. Nur zwei Sachen nicht. Dieses Kind, das eigentlich noch gar nicht da sein sollte. Und mein Mann, der da sein sollte, um es begleiten zu können, es aber nicht ist. Nichts, gar nichts ist, wie es sein sollte und das Schlimmste ist, dass ich nicht weiß, über Stunden nicht wissen werde, was mit dem kleinen Menschen ist, der sich da gerade auf die Welt gekämpft hat.
Ich liege da, auf dieser Liege, friere wie ein Eisblock, werde genäht, allein gelassen. Mir laufen die Tränen, ohne, dass ich sie aufhalten kann. Warum hat mich keiner vorgewarnt, dass eine Geburt auch so verlaufen kann? Sekunden, Minuten, Stunden werden zu quälenden Ewigkeiten, in denen ich beten lerne, ohne je gläubig gewesen zu sein. Denn wir brauchen dringend, ganz dringend ein Weihnachtswunder. Bitte vor Weihnachten. Heute. Jetzt. Sofort.
Es dauert zwei Stunden, ehe eine Schwester Entwarnung gibt und mich nach deinem Namen fragt. Es wird Mittag, ehe dein Vater kommt und wir gemeinsam dich, dieses 43 cm kleine Menschenkind mit nur 1.880g in die Arme schließen dürfen. Deine seidige Haut ist viel zu groß für deine dürren Ärmchen und Beinchen, wirft überall Falten, vor allem an den Beinen, die sich schwer tun, die Ohren allein zulassen. Ohren, wie ich sie nur von Mr. Spock, dem Vulkanier kenne und dazu passen auch deine wahnsinnig dunklen Augen, die uns aufmerksam betrachten und uns und den Schwestern das Gefühl geben, als wärst du schon tausend Jahre alt und nicht gerade geboren. Aber dein Geruch ist unverkennbar der eines Babys. Duftend und zart, genau wie der helle, weiche Flaum auf deinem Kopf.
Drei Wochen später, am Weihnachtstag, dürfen wir das Krankenhaus mit dir verlassen. Mit dir, unserem ganz persönlichen Weihnachtswunder, unserem Dezemberkind. Und wir zwei sitzen, endlich wieder zu Hause, ganz ohne Weihnachtsbaum, halten dich abwechselnd in unseren Armen, wachen über deinen Schlaf, freuen uns über jede deiner Bewegungen, jeden zarten Ton, den du von dir gibst. Wir sind uns einig: wir wollen dich nie wieder loslassen. Denn du bist das kleinste und gleichzeitig größte und schönste Geschenk dieser Welt. Eines, das uns den Atem raubt und unsere Herzen mit unvorstellbarer Liebe flutet.
Irgendwann bist du in deine Haut hineingewachsen, hast die ersten Schuhe verwachsen, die Pubertät durchgemacht, das Abitur geschafft, und wir durften an dir wachsen. Tag für Tag. Jahr um Jahr. Durften lachen, weinen, staunen, grübeln, deinem Klavierspiel lauschen, helfen, dich machen lassen und unser Glück mit dir jeden einzelnen Tag genießen.
Immer, immer werde ich deine kleinen Ärmchen um meinen Hals spüren, deine feuchten Küsse auf meinem Gesicht und dich sagen hören: „Mama, ich hab dich sooo lieb.“ Denn das sagst du auch heute noch, wenn auch nicht mehr so häufig. Heute, wo du auf mich herabblickst mit deinen einem Meter und achtzig.
Tage, Wochen, Monate…wie viele werden es wohl noch gemeinsam unter einem Dach? Wie lange noch, bis du deine Sachen packen und dir eine neue, eigene Bleibe suchen wirst? Ich will es gar nicht wissen. Ich will jeden einzelnen Tag bis dahin und darüber hinaus einfach als Geschenk betrachten und dankbar sein. Denn egal, wie es kommt, und es kommt immer anders: Lebe, denn Leben ist das was passiert, während du andere Pläne machst.
Bald ist wieder Dezember. Dein Geburtstag und Weihnachten stehen vor der Tür, mit hellem Kerzenschein, Lebkuchenduft, heißer Honigmilch, deinen geliebten Dominosteinen, Weihnachtsmarkt und viel Lachen in unserer Familie und mit Freunden.
„Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag, mein Großer! Du bist mein Wunder.“
![]()
Benutze diese Vorlage für bessere Sichtbarkeit: