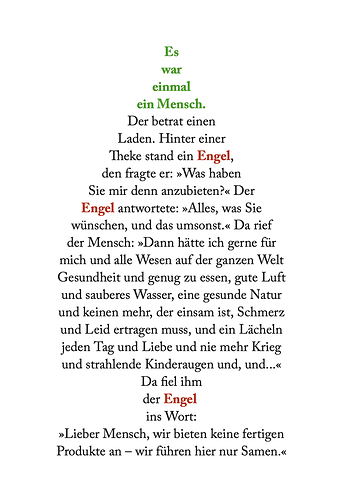Als Aram seinen Glauben fand
Es war der 20 Dezember 1957. Long Island lag unter einer winterlichen Schneedecke. Die Weihnachtsferien hatten begonnen, in der Schule herrschte Hochbetrieb. Die Vorbereitungen für das Krippenspiel lagen in den letzten Zügen und fast jeder meiner Schulfreunde nahm daran teil, außer mir.
Unser Haus war ebenso geschmückt und die Lichterketten funkelten mit denen unserer Nachbarn um die Wette. Meine Freunde konnten den 24 Dezember kaum abwarten. Nach der Weihnachtsfeier würden am nächsten Morgen die Geschenke unter dem Baum liegen.
In unserer Familie war das anders. Wir feierten die Ankunft Jesu am 6. Januar.
Als achtjähriger wurde ich deshalb von meinen Schulkameraden ausgelacht und gehänselt. Da half es auch nichts, dass unser Klassenlehrer von Millionen orthodoxer Christen berichtete, die ebenso wie ich am 6. Januar feierten.
Ich war genervt, denn ich wollte nicht anders sein, als die anderen. Deshalb erklärte ich am Abend des 23. Dezember meinen Eltern, dass ich wie meine Mitschüler und Freunde feiern wollte.
Meine Mutter sah mich eine Weile an und sagte dann zu meinem Vater: „Es wird Zeit für das Gespräch.“
„Welches Gespräch?“, platzte es aus mir heraus.
Vater nickte und ging mit mir in das Kaminzimmer, wo wir es uns gemütlich machten. Das Feuer prasselte und gab seine wohlige Wärme in den Raum ab.
Papa war Architekt und hatte unser Haus selbst entworfen und mit seinem eigenen Bauunternehmen aufgebaut. Er war sehr stolz darauf und erzählte allen unseren Gästen, dass zu jeder Tageszeit und egal wo die Sonne stand, alle Räume lichtbeschienen wären. Bis zu diesem Tag wusste ich nicht, wie privilegiert meine Familie war. Wir konnten uns reich nennen. Für mich war das allerdings normal, denn ich hatte keine Armut kennen gelernt.
„Wir feiern das Weihnachtsfest am 6. Januar, weil wir Armenier und gregorianische Christen sind“, begann er.
Dass wir Armenier waren wusste ich, aber alles andere hatte mich bis dahin nicht interessiert.
„Der heilige Gregor machte uns zu den ersten Christen dieser Welt, aber das ist eine andere Geschichte. Mein Vater Aram.“
„Dede“, unterbrach ich ihn.
Papa nickte. „Ja, dein Dede. Er lebte mit seiner Frau Miriam und seinen Söhnen Hayk und Arman, die zwei und fünf Jahre alt waren, in Ostanatolien. Das ist bis heute die Türkei.“
Mein Interesse war geweckt, denn ich wollte die Geschichte von Dede und meinem Vater, Arman hören. Allerdings kannte ich keinen Onkel Namens Hayk und keine Jaja namens Miriam. Doch bevor ich noch fragen konnte, erzählte der weiter.
„Es war das Jahr des Genozids.“
Ich schaute ihn verständnislos an.
„Genozid bedeutet, die Auslöschung eines Volkes durch ein anderes“, erklärte er.
„Wie die Juden in Deutschland?“ Davon hatte ich in der Schule gehört und mein Freund Isaac war ein Jude.
„Ja, genauso. Die Armenier waren unerwünscht und so hatte man begonnen sie aus ihren Häusern zu holen, Männer, Frauen und Kinder ohne Unterschied.“
„Was ist mit ihnen passiert?“, fragte ich und mir fröstelte dabei.
„Man hat sie von überall her aus dem Land zusammengetrieben und nach Osten in die syrische Wüste geführt. Es war ein Todesmarsch ohne Wiederkehr. Die Schwächsten unter ihnen starben unterwegs an Durst und Hunger, der Rest bei Aleppo.“
Er machte eine Pause, weil ihm die Erzählung sichtlich schwerfiel.
„Weiter, weiter“, drängte ich.
Er schluckte mehrmals, bevor er weitersprach. Seine Stimme brach bei den ersten Worten, aber dann berichtete er flüssig, als ob er es hinter sich bringen wollte.
„Dein Dede kam eines Tages von einer kurzen Handelsreise nach Hause, die er abgebrochen hatte, als er von dem Beginn der Deportationen erfuhr. Die Tür stand offen, das Haus war verwüstet. Türken, die ihm unbekannt waren, gingen ein und aus und schleppten alles weg, was nicht niet und nagelfest war. Dede rannte von Zimmer zu Zimmer und suchte nach Jaja und seinen Söhnen, aber er fand sie nicht. An der Tür traf er einen seiner Nachbarn, der ihm wohlgesonnen war. –Wo ist meine Familie-, fragte er ihn. – Sie wurden abgeholt. Jeder Armenier aus unserer Stadt wurde das. Ali, der Nachbar nahm Dede mit in sein Haus, wo er ihn versteckte.“
Ich saß auf dem Teppich vor dem Kamin und hörte gebannt zu. Ich konnte die Augen nicht von ihm wenden. Papa streckte die Hand aus und strich mir über die Wange.
„Das ist nicht das Ende der Geschichte“, sagte er. „Nach einigen Tagen verabschiedete sich Dede von Ali, um seine Frau und Kinder zu suchen. –Sei vorsichtig, Aram und gib dich nicht zu erkennen- riet ihm sein Nachbar. Ali hatte ihn mit Wasser und Proviant versorgt. Sie umarmten sich zum Abschied, der Türke, der ihn unter seinem Dach aufgenommen und versteckt hatte und der Armenier. Sie sollten sich nie mehr wiedersehen.
Wochenlang lief er Richtung Osten. Unterwegs gab er sich als Ahmet aus. Er ernährte sich von Beeren und Obst, das er sich von den Feldern und Gärten stahl. Manchmal erbettelte er sich etwas Brot in den Dörfern, an denen er vorbeikam. Hier und da hörte er auch von den Menschenkolonnen, die vorbeigezogen waren. Dann kam der Tag, an dem er auf die ersten Toten am Wegesrand stieß. Von weitem schon drang ihm der Gestank verwesenden Fleisches in die Nase. Und dann sah er sie, aufgedunsene Körper. Dort wo sie gestorben waren, hatte man sie liegen lassen. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie zu verscharren. Dein Dede folgte diesem Weg des Todes, Tag um Tag, auf der Suche nach seiner Familie. Am Anfang waren es alte und gebrechliche Menschen, die nicht mehr weitermarschieren konnten. Mit der Zeit wurden sie immer jünger. Jeden Toten schaute Dede sich an, während er zu Gott betete, dass seine Lieben nicht darunter sein mögen.“
Vater hatte aufgehört zu sprechen. Er stand von seinem Sessel auf und legte zwei große Holzscheite in das heruntergebrannte Kaminfeuer nach. Ich saß auf dem Teppich und konnte mich nicht rühren. Papa hatte das bemerkt. Er kniete sich vor mich hin und nahm mich in die Arme.
„Vielleicht bist du noch zu jung für diese Geschichte“, sagte er.
Heftig schüttelte ich den Kopf. „Bin ich nicht. Ich will den Rest wissen. Wie ging es weiter? Hat Dede seine Familie wiedergefunden?“ Das musste er doch, dachte ich bei mir, denn mein Vater stand ja vor mir.
Papa setzte sich wieder in seinen Sessel.
„Ja und nein“, antwortete er. „Nach Tagen des Suchens und Umherirrens, an denen er bei jeder Leiche, die er inspizierte und die nicht seine Lieben waren, ein Dankgebet gen Himmel schickte, kam es wie es kommen musste. Mitten auf der holprigen Straße fiel ihm vom weiten das kaminrote Tuch ins Auge. Als er näherkam, erkannte er die Umrisse eines zarten Körpers und rannte los. Sein Herz klopfte ihm bis zum Halse. Vor der Toten ließ er sich auf die Knie fallen und da lag sie, seine Miriam, in den Armen fest umschlungen, ihr totes Kind, Hayk.“
Ich hielt den Atem an und die Tränen schossen mir in die Augen. Im Zimmer war es still, nur das Prasseln des Feuers drang aus der Ferne an meine Ohren.
„Ein paar Meter entfernt fand er auch seinen zweiten Jungen, Arman. Ihm war der Schädel eingeschlagen worden. Das rote Tuch, das er Miriam zu ihrem letzten Geburtstag geschenkt hatte, an die Brust gepresst, blickte zornig in den Himmel und rief: „Warum? Warum hast du mir das angetan? Seine Schreie verhallten in der Weite des Landes. Er war allein weit und breit. Dort auf den Knien kauernd beschloss er nicht mehr an seinen Schöpfer zu glauben, an einen Gott der das Geschehene zuließ und der ihm alles genommen hatte. Mit eigenen Händen begrub er seine Frau und Kinder am Wegesrand. Während er das tat, verhärtete sich sein Herz und er weinten keine Träne mehr.“
„Aber“, stotterte ich. „Aber du lebst doch.“
Bevor er antworten konnte öffnete sich die Tür und Mama kam mit einem Tablett herein.
„Ein Becher Kakao wird euch guttun“, sagte sie, setzte die Getränke auf dem Couchtisch ab und ging wieder. Sie hatte Recht. Wir tranken den warmen Kakao, der unserem Gaumen und Seele gleichermaßen nutzte. So gestärkt, erzählte mein Vater weiter.
„Das kaminrote Tuch um den Hals geschlungen, streifte er ziellos umher. In den Dörfern, an denen er vorbeikam, erbettelte er etwas zu Essen und gab sich dabei als Ahmet aus. So vergingen Wochen und sein Weg führte ihn immer weiter nach Westen, Richtung Küste. Umweit des Städtchens Eskisehir, kam er an einem Bauernhof vorbei, dass ihn an sein Zuhause im Osten erinnerte. Die Türen waren eingetreten worden. Lange konnte die Gewalttat nicht her sein. Letzte Habseligkeiten lagen wahllos herum. Dede betrat das Gebäude, auf der Suche nach etwas Essbarem. Wieder ging er von Raum zu Raum, wie damals in seinem Heim in Anatolien. Es war ein armenisches Haus. Kreuze waren umgeworfen worden und im Wohnzimmer fand er eine zerfetzte Bibel, an der er achtlos vorbeiging, ohne sie aufzuheben. Warum sollte er auch. Es gab ja keinen Gott. Er schaute sich weiter um. Alles war durchwühlt, die Schränke von den Wänden gerissen. In ein paar Wochen würde das Haus komplett geplündert worden sein. Nichts würde mehr daran erinnern, dass Armenier hier gewohnt haben. So war es im ganzen Land. Er beeilte sich, bevor weitere Marodeure kamen. Gerade als er das Schlafzimmer verlassen wollte, hörte er ein Piepsen. Er schaute sich um, sah und hörte aber nichts weiter. Wird wohl eine Katze gewesen sein, dachte er bei sich. Doch da war es wieder, schon etwas lauter und jämmerlicher. Es kam von der anderen Seite des Bettes. Er lief hin und sah einen Lumpenhaufen auf dem Boden, der sich bewegte. Dede beugte sich nach unten und räumte alles beiseite. Da sah er es!“
„Was? Was sah er, Papa?“, rief ich aufgeregt dazwischen.
„Mich! Ich muss nur wenige Monate alt gewesen sein und lag da, nackt in Lumpen gehüllt. Dede traute seinen Augen nicht. Vorsichtig hob er mich auf. Er hielt mir seine Hand hin und bis heute schwört er, dass ich danach gegriffen hätte, um seinen Finger nicht wieder loszulassen. Bei der Deportation muss meine Mutter mich unter diesen Lumpen versteckt haben, in der Hoffnung, Gott würde mich retten und das hat er auch getan.
Dedes Herz quoll über vor Glück und er weinte. Bäche von Tränen rannen über seine Wangen und er schaute zur Decke hoch.
Danke Gott, Danke,
murmelte er. Dann wickelte er mich ein und verließ das Haus. Er gab mir den Namen, Hayk.“
Papa lehnte sich in seinen Sessel zurück und atmete tief durch, als ob ihm mit dem Bericht ein Stein vom Herzen gefallen wäre.
„Was ist dann passiert?“
„Dede schlug sich mit mir weiter Richtung Westen durch. Hier und da arbeitete er auf Bauernhöfen, wo er sich als Witwer, Ahmet ausgab, dessen Frau bei der Geburt des Sohnes gestorben sei. Als Tagelöhner sei er dann mit dem Kind weitergezogen. Er sorgte für mich so gut es ging. So gelangten wir, Vater und Sohn, an das Waisenhaus, das durch eine deutsche Organisation gegründet worden war und von einem Theologen Namens Dr. Lepsius geführt wurde. Das war unsere Rettung. Sie nahmen uns auf und als sie Dedes Geschichte hörten, halfen sie uns. Dede verschwieg, dass ich nicht sein leiblicher Sohn war, denn er wollte mich nicht mehr hergeben.
Dr. Lepsius besorgte uns über seine zahlreichen Kontakte die nötigen Papiere und setzte uns in Istanbul auf ein Schiff, dass uns in Sicherheit und Freiheit nach Amerika brachte.“
Papa schwieg. Lange saßen wir beisammen und sprachen nicht. Jeder hing seinen Gedanken nach.
„So hat Dede also Gott gefunden“, sagte ich.
„Ja, das hat er. Eines solltest du noch wissen. Der Tag, an dem er mich in Lumpen versteckt fand, war der 6 Januar 1918.“
Jetzt konnte ich mich nicht mehr halten. Ich sprang auf und rannte johlend um den Couchtisch herum.
„Ein Christkind. Papa ist ein Christkind“, rief ich immer wieder.
Vater lachte. In diesem Moment ging die Tür auf und Dede kam herein. Ich rannte in seine Arme und unaufhörlich rief ich weiter.
„Papa ist ein Christkind.“
Seither beschwerte ich mich nie wieder, dass wir Armenier das Weihnachtsfest am 6 Januar begingen.
Weihnachten 2022/2023 – Hripsime Rüstemyan