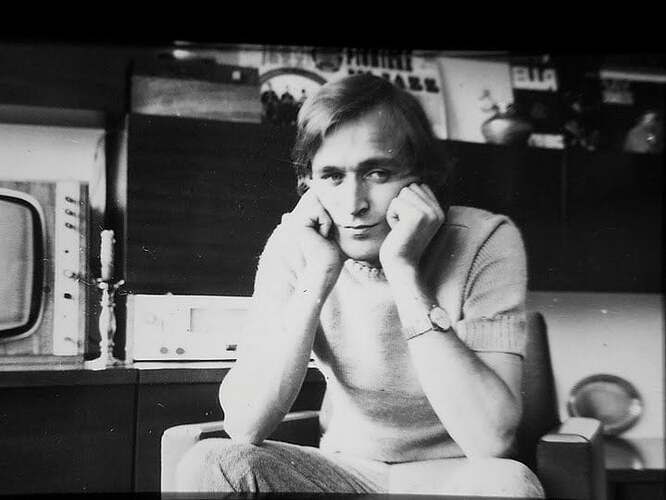Lisa
Mein Stammplatz in meiner Stammkneipe Café Stresemann in Berlin Kreuzberg ist ein Fensterplatz. Ein schwarzer Thonetstuhl vor einem gusseisernen einbeinigen kleinen schwarzen Marmorplattentischchen. Gleich links neben der Eingangstür auf einem kleinen Podest in einer schmalen Fensternische neben dem Tresen und der Zeitschriftenablage. Von dort aus überblicke ich fast den kompletten Gastraum, den Tresen und nach außen durch das Fenster den Askanischen Platz bis zur Ruine des Anhalter Bahnhofes. Das Gebäude, in dem sich das Café Stresemann befindet, ist ein altes Gebäude aus den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Es scheint durch seinen Bauhausstil fast wie neu, wie erst vor wenigen Jahren gebaut. Neben den Geräuschen des Cafés nimmt man durch das Fenster ganz schwach den Straßensound wahr. Je nach der Ampelschaltung gibt es höhere Töne zu hören, wenn die Stresemannstraße auf Grün geschaltet ist. Tiefer brummt es, wenn die Anhalterstraße grün hat. Auf dem zweiten Stuhl mir gegenüber sitzt Lisa, eine junge Frau, eine Journalistin, die ein goldglänzendes eingeschaltetes Diktiergerät langsam und sorgsam auf die ein wenig zerkratzte schwarze Marmorplatte stellt. Es ist später Nachmittag und die tiefstehende Spätsommerabendsonne scheint ihr seitlich in’s Gesicht und blendet sie. „Na dann legen sie mal los Herr Haller“, meint sie ganz locker mit linkem zugekniffenen Auge und nimmt die eben von der Kellnerin gebrachte bauchige große weiße Milchkaffeetasse zwischen ihre schlanken sorgsam manikürten Hände und führt sie vorsichtig zum schönen Mund. Ich muss lachen, denn sie hat jetzt einen grauweißen Schnauzbart vom Milchschaum über der Oberlippe. Sie hat jetzt einen Bart, so wie ich, nur meinen kann ich nicht einfach so wie sie weg lecken. „Meinen Bart habe ich mir das letzte mal vor zwanzig Jahren innerhalb meiner vierundsechzig Jahre ab rasiert und war sehr erschrocken, als ich ab dem Tag einen fremden Menschen im Spiegel gesehen hatte. Also habe ich ihn wieder wachsen lassen. Warum soll ich mit einer alten Tradition brechen. Mein Urgroßvater hatte einen Schnauzbart und mein Großvater auch“.
„Und Ihr Vater hatte, der keinen?“ „Nein, der hatte nie einen Bart, warum habe ich ihn net gefragt.“ „Der Ausdruck >>net gefragt<< Sie sind kein Berliner, wo sind ihre Wurzeln?“ Ich nehme den Salzstreuer in die rechte Hand und halte ihn Ihr vor die Augen. „Thüringen, westliches Werratal, dort wo sich die südwestliche Terrasse des Thüringer Waldes und die nordöstlichen Vorberge der Rhön im Flusstal treffen, da kommt seit undenklichen Zeiten salziges Wasser, Sole aus der Erde und erzeugte wohlhabende Bürger. Um das salzige Wasser aus der Erde entstand eine kleine Stadt an einem sehr kleinem See, aus dessen Tiefen noch heute Salzwasser sprudelt und auch in kältesten Wintern diesen See nicht vollständig zufrieren lässt. Die Stadt am See und an der Werra heißt Salzzungen, Bad Salzzungen. Da komme ich her! Da bin ich aufgewachsen, da habe ich gelebt und ein Teil meiner Familie stammte aus dieser Gegend.“
„Keine Ahnung, wo das ist, wo ist diese Gegend?“ fragt sie, und grabscht in die kleine Schüssel mit den gesalzenen Erdnüssen.
„Na, in der Nähe von Eisenach, Gotha, Erfurt, halt auf der anderen Seite des Thüringer Waldes vom Osten aus betrachtet“.
„Und von da sind auch alle verrückten Geschichten, die sie erlebt haben?“
"Nein, nicht ganz, einige Geschichten sind auch in anderen Regionen erlebt“.
Dann klingelt ihr Telefon. Sie hört eine halbe Minute zu, klappt das Handy zusammen und steht auf. „Ich muss dringend weg! Entschuldigung!“ Zwei Tage später ruft sie noch einmal an. Sie unterdrückt Weinen beim Sprechen. Brustkrebs mit Metastasen im Körper bis zu den Zehen. Zwei Monate später ist sie eingeäschert und liegt neben dem Mausoleum des Schuhkreme Fabrikanten Lemm auf dem Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Friedhof in Berlin-Charlottenburg, Fürstenbrunnerweg. Sie sah aus, wie die Trauernde mit Lyra von Hans Dammann für das Erbbegräbnis des Bankiers Ferdinand Warburg hundert Meter nördlich ihres Grabes. Sie sah aus wie meine zweite große Liebe, Traudl, deren Liebe sich an mir verschlissen hatte, lange bevor auch ihr Leben verschliss.
Lisa mit den schönen vollen Lippen, den seltenen grünen Augen kann nun nicht mehr meine Geschichte aufschreiben, die sie eh nur in vier Spalten auf einer Seite einer Wochenzeitschrift gequetscht hätte. Ein Jahr später, also heute, schreibt das jemand anders auf. Und packt es in ein Magazin, reduziert auf wenige EDV Abenteuer, die nur für EDV-affine Menschen abenteuerlich erscheinen. Im Resumé der Story meint er, er könnte eigentlich einen ganzen Roman um meine Geschichten herum backen, aber besser wäre, ich mach das.
Was macht man da? Man setzt sich selber hin und schreibt das auf. Jahrelang, fast wie Walter Kempowski in linierte Stenografenkladden, in txt Daten verschiedenster Laptops, in ein olles Nokia Handy, in odt und doc Dateien unterschiedlichster Personalcomputer:
„Mich dürstet. Mich dürstet nach dem Salz des Lebens. Mich dürstet nach Salz auf meiner Zunge. Mich dürstet nach dem Salz auf meiner Seele. Mich dürstet nach Schönheit, nach Wärme nach Schmerz. Mich dürstetet nach Leben, ehe mich etwas wie die Lisa mit den grünen Augen ungefragt abschaltet.“
Mich dürstet es immer noch! Ich hab gerade Durst auf ein mittelherbes Bier. Sitze im Stresemann. Der Platz vor mir, wo Lisa saß, ist leer. Die Buchstaben der txt-Datei im uralten Laptop sind auf vierzehn Punkt gestellt. Der Hintergrund ist grau. Meine Gedanken sind bunt. Das Bier kommt, es ist ein Berliner Pilsner!