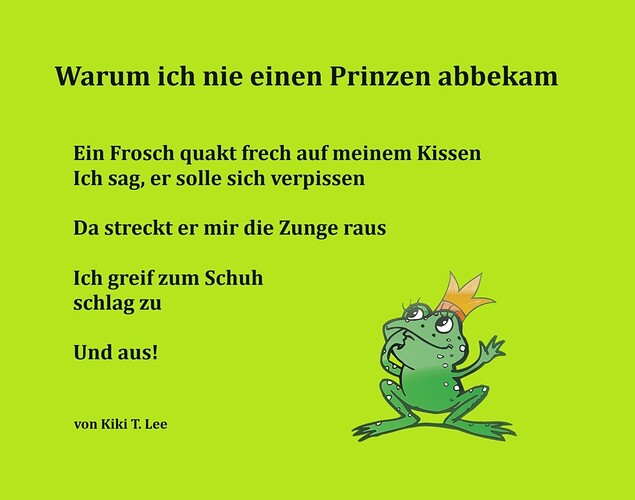3. Strategien und ihre Probleme
Der Abend war nach der Fleischbeschau, wie es Phädra weiterhin nannte, ereignislos verlaufen. Alexandria war auf die Krankenstation gebracht worden, Josephine hatte wegen des Debakels des flüchtenden Brotes einen hysterischen Weinkrampf erlitten und das Fest früh verlassen. Alle anderen waren nach ihrer Aufwartung bei dem König und der Königin in ihre Gemächer geschickt worden. Mit ihren Eltern hatte Phädra den ganzen Abend nicht mehr gesprochen. Als sie endlich bei dem Königspaar angelangt war, waren die benachbarten Plätze bereits wieder verlassen gewesen. Das war zwar nicht üblich für ihre Eltern, aber in Anbetracht der Situation auch nichts, was wirklich beunruhigend war. Phädras Bruder Panos war gerade einmal vierzehn Monate jünger und sicher wurden auch hier schon Vorbereitungen für eine Ehe getroffen. Der Viehmarkt der Eitelkeiten war in vollem Gange.
Am Vormittag des darauffolgenden Tages klopfte es an die Tür zu Phädras Gemächern. Penelope und Rudolf sahen etwas blass und müde aus, als sie eintraten. Der weiße Rand um die Lippen ihrer Mutter war immer noch oder schon wieder deutlich zu erkennen. Wirklich beunruhigt war Phädra aber über die tiefe Falte, die sich zwischen den Augenbrauen ihres Vaters gebildet hatte. Die beiden hatten den üblich distanzierten Kontakt zueinander, aber Rudolf hatte sich schon fast ungewöhnlich engagiert um die Erziehung seiner Kinder bemüht. Im Ort wurde sogar getuschelt, dass Phädra und ihre Geschwister tatsächlich seine Kinder wären, so auffällig war sein Verhalten.
Jetzt atmete ihr Vater tief durch und setzte an, etwas zu sagen. Sein Blick ruhte kurz auf Phädras Gesicht, dann schloss er die Augen und richtete seine ganze Konzentration auf die Fliesen im Empfangsbereich der Gemächer, wo sie sich alle drei auf den Sesseln niedergelassen hatten.
„Phädra, du weißt, dass deine Tante und der König angekündigt hatten, dass sie bei der Wahl deines Gatten Mitspracherecht verlangen“, begann er und Phädra nickte, auch wenn er das bei seiner Flieseninspektion nicht sehen konnte.
Penelope wand sich in ihrem Sessel.
„Wir haben gestern lange mit den beiden verhandelt und sind zu einer Einigung gekommen“, fuhr er fort. Die Mutter schnaubte verächtlich.
„Einigung! Als hätten wir eine Wahl!“
„Lass es gut sein, Penelope – dadurch wird es nicht leichter“, gab er ruhig an Penelope zurück.
Phädras Magengrube zog sich schmerzhaft zusammen, als eine Panikwelle über ihr brach. Sie wurde in den Nordosten verheiratet und musste mit einem alten, faulzahnigen und warzengesichtigen Widerling Kinder zeugen. Das war es doch, oder? Konnte sie fliehen? Was tat man eigentlich, wenn man diese Ehe nicht wollte? Wieso hatte sie sich nie darüber Gedanken gemacht?
Ihr Vater räusperte sich und setzte neu an: „Also, es ist so, dass du heiraten wirst.“
Ach.
„Es ist ein Prinz und er ist sechsundzwanzig Jahre alt.“
Ein Prinz? Das klang jetzt nicht so dramatisch. Phädras Hirn geriet ins Stolpern, als es versuchte, Panik und Prinzen unter einen Hut zu bekommen. Kurz ging sie ihr Wissen über die Geografie Fernlands durch. Im Nordosten gab es keine Schlösser. Prinzen hielten sich dort nicht auf. Prinzen lebten nicht dort, wo es immer regnete und windig war. Prinzen waren die Söhne ihrer Tante und damit ihre Cousins. Und ganz sicher musste sie mit ihm deswegen auch keine Kin…
„… in Tziochrien.“
„Entschuldigung?“, war das Einzige, was Phädra hervorbrachte. Ihr Vater hatte sich sicherlich nur verschluckt. Es war ein röchelndes Husten gewesen, das sie gehört hatte, richtig? Ihr Gehirn stolperte jetzt über seine eigenen Windungen. Die Gedanken in ihrem Kopf rauschten so laut, dass sie die nächsten Worte, die ihre Mutter sprach, kaum verstand.
„Das Königshaus hat beschlossen, die Beziehungen zu Tziochrien zu festigen. Seit Monaten tauschen sich Diplomaten beider Länder aus und nun sollen die Verhandlungen besiegelt werden. Natürlich warst du die erste Wahl als direkte Nichte der Königin, aber es ging auch darum, wer uns im… im Ausland am würdigsten repräsentiert - und nach gestern warst du eine der wenigen, die in Frage kam oder mit anderen Worten: das Brot liegen ließ. Eine zweite befindet sich gerade in der verdammten Krankenstation und erstickt halb an einer Bohne. Und die dritte ist… Ottilie.“
Ottilie zu Horborg-Rhoden war eine wundervolle Persönlichkeit. Sie war freundlich, eine sehr gute Zuhörerin, aufmerksame Beobachterin und ihr fehlten die Schneidezähne sowie ein Nasenloch, nachdem sie als Kind herausgefunden hatte, das ein wilder Eber nicht mit ihr im Wald Beeren pflücken gehen möchte. Ottilie hatte bei der Fleischbeschau das Brot liegen gelassen, weil sie gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, davon abzubeißen. Nur kurz konnte sich Phädra mit diesem Gedanken ablenken.
„Tziochrien?“
„Liebstes Kind, es soll dort viele wundervolle Landschaften geben“, versuchte es der Vater.
„Einem Tziren-Prinzen?“
„Die Diplomaten lassen ausrichten, dass er, sofern er sich gezeigt hat, keine auffälligen oder gefährlichen Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat.“
„Keine gefährlichen?“, zischte Phädra. Ihr Herz begann zu rasen, während sich all das Wissen, die Gerüchte und Mythen um die Tziren und ihre Klans in ihr Bewusstsein drängte und wie Schulkinder mit gereckten Ärmchen und fuchtelnden Händchen um ihre Aufmerksamkeit wetteiferten. Tziren sind Barbaren. Sie leben in Höhlen. Sie jagen mit Knüppeln. Ihre Frauen dürfen die Behausungen nie verlassen. Sie sprechen nicht, sie grunzen.
War das die Rache für den Ärger, den sie den anderen Mädchen mit Gisela eingebrockt hatte? War Minnies Äußerung, dass das Königspaar angereist war, um Phädra mit einem Prinzen zu verkuppeln, in Wirklichkeit ein fieser, lange geplanter und perfide durchgeführter Fluch gewesen? Waren ihre Freundinnen gar keine Freundinnen, sondern Racheengel mit großen, glänzenden Kalbsaugen? Und überhaupt! Wie prinzig konnte ein Tziren-Prinz schon sein?
„Sie grunzen!“, schrie Phädra: „Tziren grunzen!“
Dann sprang sie auf und ihr Sessel kippte erschrocken um.
„Na, na, Kind. So ist es nicht. Im Süden unterhalten sich unsere Leute auch mit den tziochrischen Händlern und auch die Diplomaten versicherten, dass sie nicht nur sprechen, sondern auch unsere Sprache beherrschen.“
Phädras Vater erhob sich und richtete ihren Sessel wieder auf.
„Aber warum denn ich? Alexandria ist doch bald wieder auf den Beinen. Oder wir machen ein zweites Festmahl. Ich kann nicht nach Tziochrien! Ihr könnt mich nicht zu Wilden schicken!“
Penelope seufzte.
„Das bleibt unter uns. Diese ganze Ehe-Geschichte ist nur ein Teil eines wesentlich komplexeren Planes für die Zukunft. Deine Ehe wird so schnell vorbei sein, dass du nicht mal die Augenfarbe des Prinzen herausfindest. Du wirst uns da vertrauen müssen. Also eigentlich dem König und der Königin. Sieh es vielleicht mehr als ein Abenteuer. Einen Ausflug unter bestmöglichen Bedingungen. Und Tziren heiraten immer in den Beginn des neuen Jahres, also um Mitternacht am 31. Dezember. Damit lassen sie ihr altes Leben mit dem alten Jahr zurück. Aber ehe du dich versiehst, bist du…"
„Penelope“, schritt Rudolf ein.
„Ja, also, bist du, äh, hast du genau wie hier die freie Wahl. In Ordnung?“
Phädras Mutter ruderte zurück. Sie war möglicherweise die mit Abstand schlechteste Lügnerin, die je durch das Reich der Fernen gewandelt war. Sie war so schlecht, dass man vor Auffälligkeit vermuten musste, dass die Lüge nur vorgetäuscht war und Penelope die Wahrheit sprach.
„Habt ihr… ein Bild?“, fragte Phädra matt.
„Er hat sich geweigert, eines erstellen zu lassen. Es tut uns leid.“
Na wundervoll. Es war klar, das konnte nur eines bedeuten: Der Prinz war hässlich. Oder alt. Oder beides.
„Wie heißt er?“
„Rafael vom… Finsterwald.“
Eigentlich klang das recht verwegen, fand Phädra. Auf eine attraktive Art und Weise. Dieser kleine Funke Optimismus erlosch so schnell, wie er aufgeglommen war.
„In der Nacht vor Neujahr? Aber… aber das ist in zwei Wochen! Das ist… das ist… ist… in zwei Wochen!“
Phädras Atmung spielte verrückt. Sie klang wie ein hechelndes Mastkarnickel, das vor einem Jagdhund floh. Ihr Gesicht wurde kalt. Dann ihre Fingerspitzen. Speichel lief flutartig in ihrem Mund zusammen und ihre Lippen wurden taub.
„Phädra! Reiß dich zus… oh… Rudolf, schick bitte nach einem Bediensteten, der dieses kleine… Malheur entfernt.“
Phädra hatte sich vor den Füßen ihrer Mutter erbrochen. Zum zweiten Mal in ihrem Leben hatte sie sich übergeben. Das erste Mal blieb davon emotional unberührt, denn in einer Mutprobe hatte ihr jüngerer Bruder ihr unterstellt, sie würde die riesige und haarige Techt-Spinne nicht essen, die ein Bediensteter zwar erschlagen, aber dann seit inzwischen drei Tagen nicht entsorgt hatte. Diese arme Spinne war definitiv zwei Tode gestorben und Phädra würde den Geschmack von verwesender Spinne nie wieder vergessen, vermutete sie. Jetzt und hier hatte sie aus ganz anderen Gründen ihren Mageninhalt wieder hergegeben. Dahin war es, das gute Frühstück und der leckere schwarze Tee. Und anders als bei der Spinne war die Übelkeit auch weiterhin omnipräsent. Ihr war schwindelig und Tränen schossen ihr in die Augen. Ihre Gedanken rasten so schnell, dass sie nicht einen zu fassen bekam. Oder sie dachte gar nicht. Sie war sich nicht vollständig sicher.
„Kind, wir versprechen dir, dass es sich bei dieser Heirat um ein rein politisches Ereignis handelt. Du bekommst den Prinzen vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde zu sehen. Dann geht ihr eurer eigenen Wege. Zwar ist die Kultur der Tziren anders, aber das ist alles bereits organisiert. Du musst dir wirklich überhaupt keine Sorgen machen.“
Penelope klang fast wie eine etwas rostige Gebetsmühle. Mit Sand im Getriebe.
„In den kommenden zwei Wochen bereitest du dich auf die Zeremonie vor. Du könntest es auch von dieser Seite betrachten: Du wirst gerade einmal einen halben Monat damit verschwenden, dich in die Kultur Tziochriens einzuarbeiten, danach kannst du das alles wieder vergessen und ein königliches Leben nach deinem Geschmack und Willen führen.“
In den darauffolgenden Stunden hatte Phädra sich die Worte ihrer Eltern durch den Kopf gehen lassen. War sie ehrlich, dann musste sie zugeben, dass sie sich an dem Gesagten festklammerte wie eine Klette am Schweif eines Pferdes. Hinter vorgehaltener Hand hatte ihr Vater ihr noch versichert, dass er nicht die vollständigen Pläne des Königspaares verraten konnte, aber dass seine Tochter gerade darin besondere Zuversicht schöpfen konnte. Sie war nur ein Teil einer größeren Strategie. Und sie hatte den Vorteil, eine Verwandte der Königin zu sein – die würde man ja wohl kaum in den Schlossanger schubsen.
Zwei Wochen. Bereits morgen würde die Schneiderin kommen und Maß für die notwendigen neuen Kleider nehmen. Alles würde genau so ablaufen, als gäbe es keine weiteren Pläne, sondern nur eine Hochzeit zwischen zwei Ländern, die sich seit eh und je suspekt waren.
Es klopfte zaghaft, dann öffnete sich die Tür zu den Gemächern einen Spalt.
Minnie flüsterte: „Bist du… in Ordnung?“
Die Neuigkeiten hatten also schon die Runde gemacht.
„Kommt rein.“
Minnie, Elsa und Gwen schlichen mehr, als dass sie liefen. Etwas betreten stand Elsa vor dem feuchten Fleck am Fuße des Sessels, der einst ein Frühstück gewesen war. Kurz tippelte sie hin und her, dann zog sie den recht schweren Stuhl so weit nach vorne, dass er über dem Fleck stand, bevor sie sich setzte. Gwen hatte es gesehen und versucht, sich so zwischen Phädra und Elsa zu stellen, dass diese hochpeinliche Episode durch ihren schmalen Körper verdeckt wurde. Sie versuchte, Phädras Blick einzufangen.
„Wir wissen überhaupt nicht, was wir sagen sollen, Phädra…“
Erneut herrschte betretenes Schweigen.
„Wie heißt er und wie sieht er aus?“, platzte es aus Minnie. Direkt danach rauschte eine Röte über ihre Wangen und sie fächelte sich mit der Hand Luft zu.
„Rafael und ich weiß es nicht. Er wollte kein Bild von sich anfertigen lassen“, gab Phädra tonlos zurück.
„Ohohje“, murmelte Gwen.
„Ist er ein… Barbar?“, quiekte Minnie, die immer noch fächelte, ohne dass es irgendeine Auswirkung auf ihre fleckige Gesichtsfarbe hatte.
„Mutter hat mir versichert, dass die Diplomaten, die ihn gesehen haben, gesagt haben, dass er keiner ist.“
„Ooohje.“
Stumm saßen die vier auf ihren Sesseln. Dann brach es aus Gwen heraus:
„Du musst dir einen Fluchtplan machen, Phädra! Wir finden bestimmt einen Weg, dich irgendwo so lange zu verstecken, bis dieser Höhlenmensch dich vergessen hat – das kann ja nicht allzu lange dauern, oder?“
Es entbrannte eine wilde Diskussion über die üblichen Vorgehensweisen, wenn man floh, wie man in einem Wald überlebte, wie man Brote aus Bucheckern backen konnte, um sich zu ernähren, welche Schuhe sich am besten eigneten, wenn man länger laufen musste. Unklar war, wie man seine Notdurft außerhalb eines Klosetts verrichten konnte, wie man schlief, wenn man sich doch unmöglich auf den Boden legen konnte und welche anderen Möglichkeiten der Verteidigung es gegen Barbaren gab, außer lauthals zu schreien.
Eine Bedienstete brachte Tee und Kekse.
„Wie weit ist das denn überhaupt weg? Einen Tag?“, fragte Elsa.
„Es braucht drei Tage bis zu meinem Heimatort, der südlich liegt. Die Grenze ist dann noch einen weiteren Tag entfernt“, murmelte Gwen.
„Das sind ja schon vier Tage!“, hauchte Phädra, der plötzlich klar wurde, dass sie nicht noch zwei Wochen Zeit hatte, um sich mit ihrer Situation abzufinden. Es war höchstens eine Woche, abhängig davon, wie lang die Reise innerhalb von Tziochrien noch dauerte. Während sie sich in die Armlehnen ihres Sessels krallte, konzentrierte sie sich mit geschlossenen Augen auf ihre Atmung. Die Kekse wollte sie gerne bei sich behalten. Hektisches Getuschel legte nahe, dass Gwen und Elsa, die ihr gegenüber saßen, überlegten, ihrerseits eine taktische Flucht anzutreten.
Es wird alles gut. Es wird keinen Monat dauern, dann bin ich wieder hier und diese ganze Sache ist durchgestanden. Die Gebetsmühlen setzten sich knirschen in Gang. Phädra öffnete die Augen.
„Ich glaube, ich wäre jetzt gerne alleine. Danke, dass ihr mich besucht habt, ihr Lieben. Euer Beistand ist mir wichtig und stützt mich.“
Die drei jungen Frauen nickten. Keine von ihnen hatte auch nur ein Wort darüber verloren, ob sie schon wussten, wer ihre Ehepartner sein würden. Entweder wussten sie es noch nicht, oder ihnen war klar, dass sie damit im schlimmsten Fall Salz in klaffende Wunden rieben.
In der Nacht lag Phädra hellwach in ihrem Bett. Es hatte keinen Sinn, sie konnte nicht schlafen. Also beschloss sie, etwas zu tun, was sie seit Monaten nicht mehr getan hatte: Sie würde die Bibliothek aufsuchen. Das war verboten und sie hatte schon mächtig Ärger dafür bekommen, aber wer würde schon einer angehenden Barbarenprinzessin den letzten Wunsch verwehren? Und sie wünschte sich nachzusehen, ob die Bibliothek irgendwelche Literatur über die Tziren vorzuweisen hatte.
In ihren Morgenmantel gehüllt schlich sie sich in den großen Saal, in dem Staub diesen ganz eigenen Geruch hatte. Er erinnerte an eine Mischung aus getrocknetem Pferdemist und Sand, mit einer Prise fauliger Tierhaut. Der Saal war immer beleuchtet, was es ihr in der Vergangenheit schwer gemacht hatte, sich unbemerkt mit Wissen zu versorgen, auch wenn nachts nur selten Wachen nachsahen, ob sich Eindringlinge über die Bücher hermachten.
Phädras erster Weg führte zur Sektion über Kulturen. Hohelieder der Fernen. Traditionelle Gewänder. Mehrere Benimm-Almanache. Drei Bücher über Schuhwerk. Unzählige Gedichtbände fernscher Meister. Als Nächstes suchte sie die Geografie-Sektion auf. Alle Bücher waren offensichtlich nach den Himmelsrichtungen sortiert: Der Norden, Osten, Süden und Westen Fernlands. Im letzten Regal auf Fußtritthöhe fand sich ein Büchlein, das aussah, als wäre es maximal durch drei Hände gegangen, so neu und ohne Knicke war es: „Kleine Inseln entlang der Nordküste“. Niemand, der halbwegs bei Verstand war, wollte sich bei Wind und Regen auch noch auf einer unbewohnten Insel aufhalten, die im Übrigen aber ebenfalls zum Reich der Fernen gehörte. Suchend blickte Phädra sich um. Sie kannte alle Sektionen gut, zumindest hatte sie das geglaubt. Jetzt war sie ratlos, denn ihr wollte partout nicht in den Sinn kommen, ob und wo sie je ein Buch über Tziochrien gesehen hatte. Sie konnte spüren, wie der Frust in ihr zu brodeln begann und sich wie eine Pranke um ihr Herz legte. Ihre Haut brannte unangenehm, als sie einen letzten Versuch unternahm und die Sektion ‚Sonstiges‘ aufsuchte. Dieser Bereich lag in der dunkelsten Ecke auf der linken Seite des Saales und umfasste zwei Regalreihen. Natürlich die untersten. Hier fand man Werke wie die peinlichste Sonett-Sammlung, die je von einem Fernen verfasst wurde: „Kraul mich, graul mich“ von Hildegard von Jochstein-Vogelfrei. Außerdem drei Bildbände mit außerordentlich schlecht umgesetzten Porträts. Man hatte alles versucht und jede Adelsfamilie gebeten, nach bekannten Gesichtern zu schauen, aber entweder waren in diesen Bändern keine Fern-Familien dargestellt oder es waren überhaupt keine Porträts. Dafür sprach, dass hin und wieder einzelnen Abgebildeten ein Ohr oder ein Auge fehlte.
Vor dem Regal hockend hatte Phädra ihren Kopf auf die Seite gelegt und entzifferte die Titel auf den Buchrücken. Nichts. Ein Band war unbeschriftet und so zog sie ihn hervor. „Wissenswertes über das Land der Tziren“. Phädras Herz tat mehrere aufgeregte Sprünge, auch wenn dieser Band kaum mehr als zwanzig Seiten hatte.
„Das Lant im Sühden des großartigen Reiches der Fernen ist warm und wilt. Hir leben die Tziren in Hölen und verstendigen sich mit Lauten, die an das wilte Schwain erinnern.“
Phädra wand sich kurz, während sie sich auf die vielen, fast absichtlich wirkenden Schreibfehler einstellte. Dann las sie weiter. Zwölf der zwanzig Seiten waren mit Zeichnungen belegt – von der Geografie der Halbinsel, hust, über Landschaftsmalereien mit und ohne Gebirge bis hin zu wenig kunstvollen Darstellungen von Wesen, die an Menschen erinnerten und vor Höhleneingängen mit gekrümmten Rücken und langen Armen Stöcke und Keulen in die Luft reckten.
„Die Tziren brodutziren einen sehr guten Wein und auch ir Gebäk ist schmaghafd.“
Für die Herstellung von Wein brauchte es gut gepflegte Reben und einen komplexen Vorgang, damit aus Trauben tatsächlich etwas Genießbares wurde. Ähnlich verhielt es sich mit dem Backen, grübelte Phädra. Wie sollte ein Volk, das grunzend Keulen schwang, so etwas bewerkstelligen. Bei Festen wurden häufig tzirische Weinen gereicht und es galt als gute Sitte, diese Weine in Krüge umzufüllen. Das Problem war, so hatte Phädra einst aus einer Unterhaltung zwischen zwei Mägden entnommen, dass die Flaschen, in denen die Weine geliefert wurden, mit wunderschönen, farbenfrohen und kunstvoll beschrifteten Etiketten versehen waren. Das war derart aufwühlend, dass es dem Adel der Fernen nicht geziemte, diesen Anblick ertragen zu müssen.
Mit einer Keule malt man solche Etiketten nicht, dachte Phädra. Lustlos blätterte sie zwischen den Seiten des unterirdisch schlecht geschriebenen Bandes. Nichts von dem, was sie gelesen hatte, war ihr neu. Eher hatte sie den Verdacht, dass alles, was sie je über Tziochrien gehört hatte, Nacherzählungen genau dieses Werkes waren. Der Autor war Jochen zu Fröhenbergen – der Name sagte ihr rein gar nichts.
In den kommenden Tagen geschah alarmierend wenig. Die Schneiderin hatte bei Phädra Maß genommen. Ein Schuster hatte das ebenfalls getan, nur an ihren Füssen. Sie wurde wohl mit einem Paar Reiseschuhe ausgestattet, denn die meist langen Spitzen der fernschen Adelsschuhe, so wie sie seit zwei Jahren im Trend lagen, hatten sich auf Kutschreisen als problematisch erwiesen, wenn mehrere Personen reisten. Nach einem Todesfall, der mit einem Adelsschuh und einem Schlagloch zusammenhing, waren Reiseschuhe nun eine unausgesprochene Pflicht.
Elsa, Gwen und Minnie besuchten Phädra in ihren Gemächern, waren aber selbst weit mehr eingespannt, als man das von Phädra behaupten konnte. Gwen würde den Sohn des Nachbardistrikts ihrer Heimat heiraten. Die Gutshäuser der Eltern lagen drei Dörfer voneinander entfernt und mit einem halbstündigen Ritt zu erreichen. Gwen und ihr baldiger Ehemann kannten sich von verschiedenen Festivitäten und waren sich herzlich egal. Elsa hatte es noch besser getroffen: Sie heiratete einen Greis, dessen letzte Ehefrau sich zeit ihres Lebens die Besorgung von Nachkommen gespart hatte. Das Königspaar hatte angeordnet, dass diese alte Blutlinie nicht daran scheitern sollte, dass Graf Benzke von Warrenhausen kinderlos blieb. Zwar befanden sich die Ländereien von Warren etwas weiter von ihrem Elternhaus entfernt, dafür trumpften sie mit einem Strand-bestückten Küstenabschnitt und einem weitläufigen und sehr fruchtbaren Flussdelta. Die große und beliebte Metropole Warringen zog die Jungen und Reichen an und Elsa würde keine Mühe haben, aus einem reichhaltigen Sortiment potenzieller Väter für die Nachkommenschaft des Grafen zu sorgen.
Minnies Vermählung stand noch aus. Die Verhandlungen liefen zäh, weil sich der angedachte Ehemann unglücklicherweise in eine andere junge Adlige verliebt hatte, wie er behauptete. Deren Eltern wiederum waren nicht bereit, sie als Konkubine freizugeben, denn diese Position ließ sich sehr viel schwerer in Verhandlungen nutzen. Für Minnie würde das entweder bedeuten, dass sie den Bruder des Auserwählten heiraten würde, der derzeit allerdings erst acht Jahre alt war, oder es musste ein ganz neuer Kandidat gefunden werden – und dann würden alle Verhandlungen von vorne beginnen.
Alle jungen Frauen, die jetzt heirateten, waren mit allerlei Vorbereitungen beschäftigt. Zu gerne hätte Phädra sich den Unterhaltungen und Planungen angeschlossen, aber wann immer ihr eine Frage gestellt wurde, konnte sie nur die Schultern hochziehen und den Kopf schütteln. Wo würde sie wohnen? Waren die Eltern des Ehemannes in der Nähe? Wie war die Auswahl an Männern im Allgemeinen? Gab es regional begrenzte Modetrends? Wer war die beste Haarflechterin vor Ort? Nichts davon war über Tziochrien bekannt. Auch wenn Phädra immer wieder das Aufwallen der Panik spürte, schaffte sie es, nach außen ruhig zu wirken. Immer wieder führte sie sich dann die Pläne des Königspaares vor Augen und beruhigte sich damit, dass alle diese Details für sie so oder so nicht relevant waren, weil sie in höchstens drei Wochen wieder in der Heimat sein würde. Und wer die beste Haarflechterin in Fernwalde war, wusste sie natürlich. Nachdem ihr verboten worden war, über diese Pläne zu berichten und jetzt naheliegende, ausgefeilte Lügengeflechte bei ihrer Rückkehr enttarnt werden würden, zog sie es vor, komplett zu schweigen. Glücklicherweise war das auch die nachvollziehbarste Reaktion, denn alle wussten, dass sie nichts über die Tziren und ihr Reich wussten.
Zehn Tage vor dem 31. Dezember erschien ein Bediensteter und teilte Phädra mit, dass die Abreise am übernächsten Morgen bei Morgengrauen angedacht war. Kurz darauf lieferte der Schuster zwei Paare Reiseschuhe. Entschuldigend murmelte er, dass er sich so unsicher war, wie lange Reiseschuhe in der Wildnis Tziochriens überhaupt halten würden und hatte sich deswegen für ein stärkeres Leder und ein Ersatzpaar entschieden. Phädra fühlte sich nicht bereit. In ihrem ganzen Leben hatte sie noch keine Reise unternommen, die acht Tage gedauert hatte. Was tat man, wenn man acht Tage in einer kleinen, schaukelnden Kiste saß? Zumindest nicht lesen. Das hatte sie bereits in ihrer Kindheit gelernt - und dass die Kutsche noch Stunden, nachdem ihr schon vom Halten des Bilderbuches speiübel geworden war, nach Erbrochenem gerochen hatte, weswegen sämtliche ihrer jüngeren Geschwister es ihr nachgetan hatten und die Verzweiflungsschreie ihrer Mutter über Meilen zu hören gewesen sein mussten, ja, das alles hatte es nicht besser gemacht. Singen war ebenfalls keine gute Idee, auch wenn es förmlich das Einzige war, was Phädra selbst tun konnte, während sie krampfhaft aus dem Fenster gen Horizont starrte, um die Übelkeit zu verhindern, die fahrende Kutschen bei ihr auslösten. Auf inländischen Reisen hatte sie öfter eine Vorleserin mitgenommen, allerdings würde sie niemandem zumuten, mit ihr nach Tziochrien zu reisen.
Wenn ich in drei Wochen, vielleicht vier, wieder zurückkehre, werde ich wieder so lange unterwegs sein, dachte sie. Es würden also doch mindestens fünf, vielleicht sogar sechs Wochen werden, bis sie die Heimat wiedersah. Verflixt.
Insgesamt betrachtet hatte die Fleischbeschau zugegen des Königspaares und ihr offensichtlich unterdurchschnittlich ausgeprägtes strategisches Denken sie möglicherweise dem schlechtesten Handel abschließen lassen, den Phädra je abgeschlossen hatte: Die Verweigerung einer verdammten frittierten Brotscheibe hatte ihr einen Prinzen eingebrockt. Das war so miserabel, dass es vermutlich in die Annalen der Adligen Fernwaldes eingehen würde. Glückwunsch, liebe Phädra, Glückwunsch.
![]() )
)